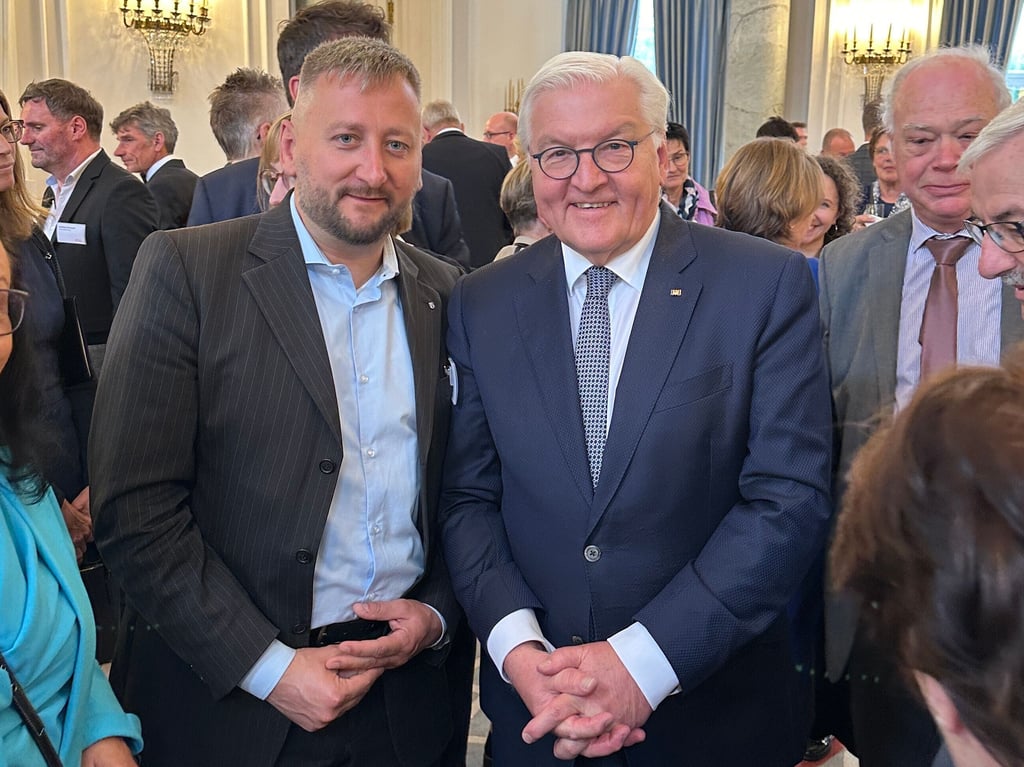Chef am runden Tisch Dominique Meyer hat erste Pläne für die Mailänder Scala
Er will auffinden, ausgraben, entdecken. Dominique Meyer ist vor seinem Wechsel an die Mailänder Scala voller Pläne. Das Urteil des Franzosen über die deutsche Opern-Szene fällt zwiespältig aus.
Wien (dpa) - Dominique Meyer sitzt an einem großen runden Schreibtisch mit sieben Stühlen. Der 64-jährige Chef der Wiener Staatsoper schafft an seinem Arbeitsplatz eine ständige Konferenz-Atmosphäre.
"So ein Tisch ist schon in Mailand eingerichtet. Ich mag das gern. Es macht die Zusammenarbeit angenehmer", sagt Meyer. Der Franzose wird nach zehn Jahren an der Staatsoper bald die nicht weniger prestigeträchtige Scala in Mailand leiten, vorübergehend sogar beide Häuser. Für Italien hat sich Meyer musikalische Entdeckungen vorgenommen.
Frage: Demnächst sind Sie zumindest für einige Monate Chef der Wiener Staatsoper und der Mailänder Scala zugleich. Wie bewältigt man das?
Antwort: Diese Posten werden manchmal auch überschätzt. Die Staatsoper ist wie eine Kriegsmaschine organisiert. Es funktioniert hervorragend - in allen Abteilungen.
Frage: Worin unterscheiden sich Mailand und Wien?
Antwort: In Wien ist die Hauptaktivität Oper und Ballett. In Mailand gibt es auch Orchesterkonzerte und Klavierabende. In Wien ist das Ensemble im Gegensatz zu Mailand fest engagiert. In der Staatsoper sind Nachtschichten nicht möglich, in Mailand schon. Wien fußt auf Repertoire, Mailand spielt "stagione", also viel weniger Stücke.
Frage: Was sind Ihre Pläne für Mailand?
Antwort: Mein Wunsch wäre, dass im Programm der Fokus auf italienische Oper gerichtet ist. Barockwerke sollte man nicht nur von Händel spielen. Viele italienische Komponisten des 17. und 18. Jahrhundert hat man vergessen. Es wäre schön, wenn die Scala eine Rolle spielen würde bei der Wiederentdeckung von Stücken. Ich denke auch an Auftragswerke für italienische Komponisten. Es gab eine Zeit - bei Claudio Abbado und Intendant Paolo Grassi - wo das üblich war. Es wäre schön, wenn das zurückkäme.
Frage: Wo steht die Oper heute?
Antwort: Die Geografie der Opernwelt ändert sich. Es gibt ein großes Interesse für die Oper in Ländern, in denen man das nie vermutet hätte. Südafrika hat eine wunderbare Sänger-Generation. Sie kommen in die Endrunden von allen großen Wettbewerben. Sie sind extrem gut. In China ist eine unglaubliche Entwicklung zu beobachten. Dort werden viele Opernhäuser gebaut. Eine Co-Produktion von "Falstaff" mit Peking hatte ein ausgezeichnetes Niveau. Wir sehen - global betrachtet - eine sehr schöne Evolution.
Frage: Die Oper hat immer noch den Ruf, Musiktheater für die Elite zu sein. Sehen Sie das anders?
Antwort: Ich höre als Juror und Juryvorsitzender mehrerer Gesangswettbewerbe, unter anderem stehe ich der Jury der "Neuen Stimmen" vor, rund 800 bis 900 Sänger in jeder Spielzeit. Mich beeindruckt, dass viele von den neuen Sängern aus sehr armen Familien stammen. Das widerspricht der Idee, dass die Oper ein Genre für die Elite ist. Es gibt viele Länder, wo man die Emotion des Gesangs noch nicht vergessen hat. Die ersten Opern waren so gedacht, dass man Emotionen vertonen und provozieren wollte. Das hat mit Bildung nichts zu tun. Daran muss man sich immer erinnern.
Frage: Welche Bilanz ziehen Sie nach zehn Jahren in Wien?
Antwort: Ich wollte immer die Lust an der Oper mindestens auf dem Niveau halten, das ich vorgefunden hatte. Neue Opern, neue Künstler, neues Publikum. In meiner Amtszeit gab es die größte Anzahl verschiedener Komponisten und Werke. Viele Stücke aus dem 20. Jahrhundert gehörten dazu, zum Beispiel ein fünfteiliger Janácek-Zyklus. In jeder zweiten Spielzeit hatten wir ein Auftragswerk für die Kinderoper. Jede Spielzeit haben wir mit unseren Aktivitäten für den Nachwuchs jeweils 15.000 bis 20.000 Kinder erreicht.
Frage: Wie sehen Sie die Opern-Szene in Deutschland?
Antwort: Sehr unterschiedlich. Aber es gibt überall gute Grundvoraussetzungen. Es ist nach wie vor beeindruckend, dass man oft nur wenige Kilometer fahren muss, um ein Opernhaus zu finden. Ich schätze das System mit einem eigenen Ensemble sehr. Das ist die Stärke in Deutschland. Was ich weniger gut finde, ist, dass es in den großen Wettbewerben ganz wenige deutsche Sänger gibt. Das ist bedenklich, denn es ist eine wichtige Seite unserer Kultur. Frankreich dagegen verfügt aktuell über eine tolle Sänger-Generation.
Frage: Im Frühjahr kamen die Vorwürfe über Missstände und Übergriffe in der Ballettschule der Oper ans Licht. Ihre Ansicht heute?
Antwort: Man muss dabei auch die Relationen beachten. Es haben sich zwei Lehrer schlecht benommen. Das bedeutet nicht, dass die Ballettschule schlecht ist. Wir haben jedenfalls umgehend gehandelt - und haben viele konkrete Maßnahmen gesetzt. Zur Wahrheit gehört auch, dass 90 Prozent der Eleven eine Anstellung finden, und dass die Compagnie sich zu 40 Prozent aus Schülern aus dem eigenen Haus rekrutiert. Das ist doppelt so viel wie zu Beginn meiner Amtszeit. Das Staatsballett ist nun eine der besten Compagnien der Welt. Zuletzt war die Auslastung im Ballett mit 99,5 Prozent höher als die der Oper.
Frage: Die Wiener Staatsoper sticht auch durch eine Vermarktung ihrer Opern im Internet hervor. Sind Sie zufrieden?
Antwort: 45 Stücke pro Spielzeit werden im Netz kostenpflichtig gestreamt. Dank unserer hochprofessionellen Technik im Haus können wir auch dem Österreichischen Rundfunk ORF das Signal anbieten, der so seinerseits sechs oder sieben Opern ins Programm nimmt. Auch die achtsprachigen Tablets mit dem Libretto und weiteren Informationen an jedem Platz sind ein besonderer Service für die Besucher.
Frage: Wie halten Sie es als Kulturmanager mit dem fallweise heiklen Thema Sponsoring?
Antwort: Der Druck der Regierungen ist enorm, dass wir Privatgeld holen. Das kann dazu führen, dass man nicht alle Aspekte bedenkt. Es gibt Sachen, die man nicht machen soll. Unsere Feiern zum 150-jährigen Jubiläum haben wir in diesem Jahr komplett mit Sponsoren finanziert. Ich hätte mich da durchaus über einen Beitrag des Staates gefreut. Man ist Opernveranstalter, Manager, künstlerischer Leiter und muss obendrein politisches Gespür haben.
Frage: Am 20. Februar sind Sie letztmals Veranstalter des besonders festlichen Opernballs. Sind Sie froh, dass es bald vorbei ist?
Antwort: Das ist der schwerste Tag des Jahres. Ich bin von sieben Uhr morgen bis spät am nächsten Tag auf den Beinen. Aber ich habe es gemocht. Es ist uns gelungen, die Künstler und das Orchester wieder ins Zentrum des Fests zu stellen. Ich wollte nicht, dass es nur ein Ball im Gebäude der Oper ist. Es ist auch wunderbar, die Verwandlung der Menschen dank prächtiger Kleider für einen Abend zu sehen - das erinnert mich immer etwas an Aschenputtel.
ZUR PERSON: Der studierte Wirtschaftswissenschaftler Dominique Meyer war in der französischen Kulturpolitik engagiert und hatte unter anderem Chefposten bei der Pariser Oper und am Théâtre des Champs-Élysées. Seit 2010 ist er Direktor der Wiener Staatsoper, die mit rund 1000 Mitarbeitern zu großen Häusern Europas zählt.