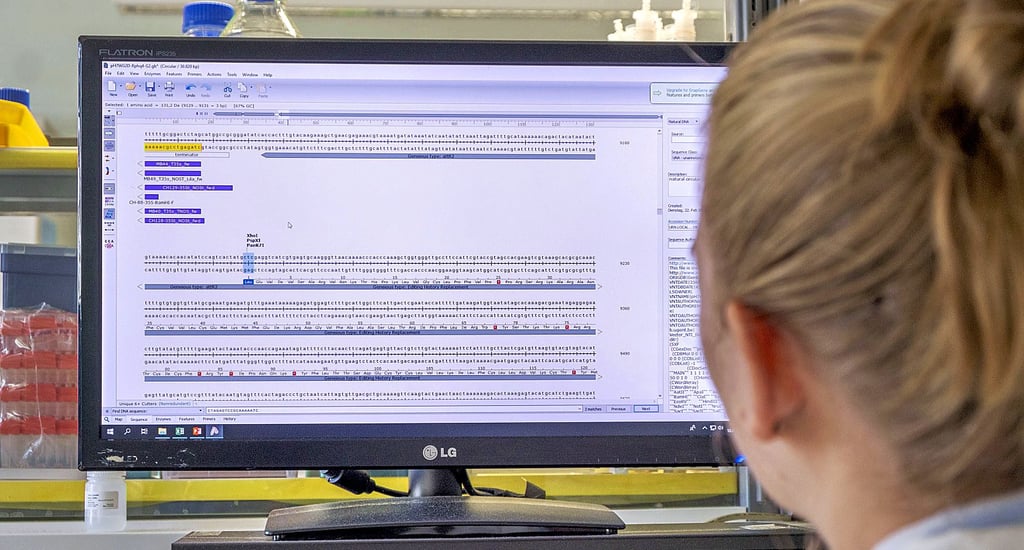Forschung Gentechnik: Wie in Sachsen-Anhalt am Getreide der Zukunft geforscht wird
Einige Bauern setzen große Hoffnungen in sie, andere möchten nichts von ihr wissen: Die Gentechnik spaltet die Landwirtschaft. Dabei arbeiten Forscher in Gatersleben schon längst mit ihr.

Gatersleben - Auf den ersten Blick fällt das kleine Feld gar nicht auf. Dabei kann man seine Bedeutung kaum überschätzen. Etwas versteckt zwischen zahlreichen Gewächshäusern wächst auf dem Gelände des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben (Salzlandkreis) nämlich die Gerste der Zukunft. Denn die Forscher haben bei den Pflanzen die Genschere Crispr angesetzt, um wichtige Eigenschaften zu verändern.
Dabei wird der DNA-Strang von Pflanzen an einer vorgegebenen Stelle im Genom geschnitten, um gezielte Mutationen herbeizuführen. „Es ist aber keine mechanische Schere, die den Schnitt vornimmt, sondern ein Enzym, das wir an die richtige Stelle schicken“, erklärt Robert Hoffie den Vorgang etwas vereinfacht. Der promovierte Biotechnologe ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Pflanzliche Reproduktionsbiologie“ am Gatersleber Institut und damit maßgeblich an den Versuchen beteiligt. „Das ist mit Abstand die wichtigste Methode, die uns in der Biotechnologie zur Verfügung steht“, sagt der 32-Jährige. Der Vorgang findet zunächst in Petrischalen statt, in denen sich Zellhaufen befinden. Nach und nach entwickeln diese sich weiter zu Pflanzen, die im Gewächshaus weiter wachsen.
Resistenz gegen Viren soll erhöht werden
Im Falle der Gerste versuchen Hoffie und seine Kollegen, sie per Modifizierung des Erbgutes resistenter gegen bestimmte Viren zu machen. Unter Umständen könnte damit die Gefahr von Ernteausfällen deutlich gesenkt werden. Dafür haben die Forscher in einer modernen europäischen Wintergerste ein Gen mit Hilfe der Crispr-Genschere in einer Art und Weise verändert, wie es in einer alten ostasiatischen Sorte vorkommt. Der Vorteil gegenüber der konventionellen Züchtung: Die Arbeit mit dem Erbgut beschleunigt die Herausbildung neuer Merkmale erheblich.
Nicht zuletzt deshalb hat die Europäische Kommission Anfang Juli vorgeschlagen, die bisher strikten Regeln bei der Gentechnik zu lockern. Auf diese Art veränderte Lebens- und Futtermittel sollen einfacher erforscht und verkauft werden können. Die Forschung in Gatersleben könnte davon einen Schub erhalten. Schließlich schließt der Vorschlag der Kommission die Crispr-Methode ausdrücklich ein.

Und auch wenn sich Hoffie mit seinem bisherigen Projekt auf die Widerstandskraft gegen Krankheitserreger spezialisiert hat, ist ein Thema in diesem Zusammenhang im Hintergrund stets präsent: der Klimawandel. Nicht wenige Landwirte setzen große Hoffnungen darauf, dass mit Hilfe der Genschere Sorten entstehen, die mit Faktoren wie Trockenheit und Hitzestress besser zurechtkommen werden.
Methode könnte beim Klimawandel helfen
Insbesondere der Wassermangel hat auch in Sachsen-Anhalt die Qualität der Erträge in den vergangenen Jahren teilweise erheblich beeinträchtigt. Die Crispr-Methode könne ein Mittel sein, um dem entgegenzuwirken, ist Hoffie überzeugt.
Ansetzen könne man beispielsweise beim Wurzelwachstum. „Es ist durchaus denkbar, Veränderungen an der Pflanzenarchitektur vorzunehmen. Etwa Sorten zu züchten, deren Wurzelwerk tiefer und verzweigter im Boden verankert ist“, sagt der Forscher. An dieser Stelle pflichtet ihm Marcel Quint bei. Der Agrarwissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittnebgerg beschäftigt sich vorwiegend mit den Auswirkungen höherer Temperaturen aufs Pflanzenwachstum.
Die Entwicklung der Wurzeln sei dabei der zentrale Baustein, damit das Getreide dem Wassermangel besser trotzt. „Das Getreide muss optimal in der Lage sein, den verfügbaren Niederschlag aufzunehmen. Das geht nur mit einem guten Wurzelwachstum“, sagt Quint. Denkbar sei außerdem, die Entwicklungsprozesse so zu steuern, dass die Pflanzen früher in die Blüte gehen und in einer kürzeren Zeit Biomasse produzieren.
Allerdings wollen die beiden Wissenschaftler die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Unmittelbar werde der Vorschlag der EU-Kommission noch keine Folgen zeitigen, tritt Hoffie auf die Bremse. „Die Entwicklung neuer Sorten bleibt auch mit der Genschere ein komplexer Prozess“, wendet er ein. Allein vom Beginn der Züchtung bis zur Zulassung einer neuen Sorte würden im Normalfall aufgrund verschiedener Reglementierungen mindestens sieben bis acht Jahre vergehen. „Und da sprechen wir vom Idealfall“, sagt Hoffie.
Bio-Landwirteäußern Zweifel
Dass vor allem Bio-Landwirte nicht mit Kritik am Kommissionsvorschlag sparen, ist ihm nicht entgangen. Grundsätzliche Zweifel löst die Gen-Skepsis bei Hoffie jedoch nicht aus: „Ich bin der Meinung, dass ein sinnvoller politischer Rahmen geschaffen wurde. Bio bleibt auf eigenen Wunsch sowieso außen vor.“ Aus seiner Perspektive ist der Unterschied zur traditionellen Sortenzucht auch gar nicht so erheblich, wie von den Kritikern dargestellt. Man arbeite mit Merkmalen, die sowieso bereits in der Natur vorkommen. „Die könnten genauso durch natürliche Züchtung entstehen. Bloß nicht so gezielt“, sagt Hoffie.